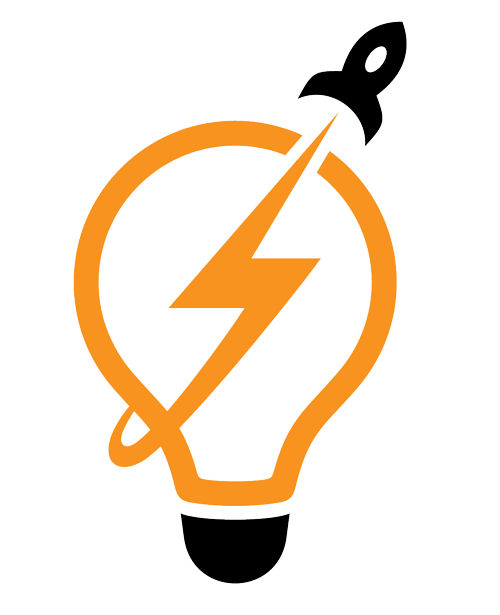Ein Businessplan folgt im Aufbau zwar grundsätzlich einer festen Gliederung, unterscheidet sich inhaltlich aber von Vorhaben zu Vorhaben. Branche, Erlösmodell und Rahmenbedingungen bestimmen, wie du Argumente, Zahlen und Nachweise aufbaust. Eine Gastronomie rechnet anders als ein Onlinehandel, ein Handwerksbetrieb anders als eine Arztpraxis. Entscheidend ist, dass dein Plan die Logik deiner Branche nachvollziehbar abbildet und für Leserinnen und Leser, vor allem für Geldgeber wie Banken und Förderinstitute verständlich ist. In diesem Beitrag zeigen wir, worauf es je Branche ankommt und wie du typische Fallstricke vermeidest. Danach folgen konkrete Hinweise und Kennzahlen für sieben häufige Branchen.
Was sich je Branche im Businessplan unterscheidet
Geschäftsmodell und Erlöslogik
Was verkaufst du genau, an wen und wie oft? Ein Café lebt von Auslastung pro Tag und Sitzplatz. E-Commerce betrachtet Warenkorbgrößen und Wiederkäufe. In freien Berufen zählen Auslastung und Tagessätze. Formuliere klar, wie Umsätze entstehen und welche Treiber du beeinflussen kannst.
Kostenstruktur: fix, variabel, Investition oder Betriebsmittel
Fixkosten fallen unabhängig vom Absatz an. Ein typisches Beispiel ist die monatliche Miete. Variable Kosten sind abhängig vom Umsatz und steigen mit dessen Höhe, wie etwa der Wareneinsatz im Handel. Zusätzlich unterscheidest du Investitionsausgaben (einmalige Anschaffungen wie Maschinen) und laufende Betriebsausgaben (zum Beispiel Software-Abos). Liste die geplanten Investitionen sowie die größten laufenden Betriebsausgaben transparent auf und erläutere ggf. welche Annahmen dahinterstehen.
Nachfrage und Vertriebskanäle
Woher kommt die Nachfrage und wie erreichst du sie? Lokale Laufkundschaft, Empfehlungen, Plattformen, Online-Marketing oder B2B-Vertrieb haben jeweils andere Planungslogiken. Notiere, welche Kanäle du priorisierst und welche Kosten je Kanal anfallen.
Regulatorische Anforderungen und Nachweise
Ein Café benötigt Genehmigungen und hat Hygieneauflagen, zulassungspflichte Handwerksbetriebe sind in die Handwerksrolle eingetragen und benötigen in der Regel einen Meister, zur Ausübung eines Heilberufs benötigst du entsprechende Qualifikationsnachweise. Lege im Text dar, welche Nachweise bereits vorliegen und welche du noch einholen musst. Das schafft Vertrauen.
Sicht von Banken und Investoren
Geldgeber achten auf Plausibilität der Annahmen, das Vorhandensein von Liquiditätsreserven, Tragfähigkeit auch bei weniger günstiger Entwicklung und auf Sicherheiten. Erkläre deine Annahmen kurz in Worten und belege sie mit Zahlen. Eine einfache Was-Wäre-Wenn-Prüfung hilft: Was passiert, wenn der Umsatz 15 Prozent unter Plan liegt oder die Kosten 10 Prozent höher sind?
Benchmarks richtig nutzen
Vergleiche mit Branchenwerten sind hilfreich, ersetzen aber nicht deine eigene Logik. Nenne Quelle und Zeitraum und erkläre Abweichungen. Wichtig ist die Konsistenz zwischen Text, Umsatzplanung, Kosten, Investitionen und Liquiditätsplanung.
Businessplan selbst schreiben oder mit externer Unterstützung?
Wann selbst schreiben sinnvoll ist
Selbst zu schreiben ist sinnvoll, wenn das Vorhaben überschaubar ist, du Zeit für Recherche mitbringst, Zahlen strukturiert aufbereiten kannst, deine Branche kennst und über grundlegende betriebswirtschaftliche Kenntnisse verfügst. Dazu zählen Basiswissen in Kostenrechnung, Preisgestaltung, Liquiditätsplanung, Gewinn und Verlustrechnung sowie ein Gefühl dafür, welche Angaben Geldgeber erwarten.
Wann externe Unterstützung Risiken senkt
Externe Unterstützung lohnt sich vor allem, wenn eine Finanzierung durch eine Bank oder Förderbank bzw. weitere Fördermittel geplant ist, mehrere Standorte oder neue Geschäftsmodelle hinzukommen oder du wenig Zeit für die Erstellung der Unterlagen hast. Der größte Vorteil ist die Risikosenkung:
- Saubere Unterlagen: Einheitliche Annahmen in Text, Finanzplan, Liquiditätsplanung und Rentabilitätsvorschau; vollständige Nachweise und Anhänge.
- Typische Fehler vermeiden: Falsch eingeschätzte Umsatztreiber, zu niedriger Wareneinsatz, fehlende Personalnebenkosten, unterschätzte Umsatzsteuer oder Sozialabgaben, verpasste Fristen bei Fördermitteln.
- Teure Irrtümer vorbeugen: Unrealistischer Breakeven-Punkt, zu geringe Liquiditätsreserven, unklare Sicherheiten oder Lücken in den Bankunterlagen.
Wenn du bankbelastbare Unterlagen mit konsistenten Zahlen, einem integrierten Fördermittel-Check und guter Vorbereitung für das Finanzierungsgespräch anstrebst, hilft dir eine Beratung zur Businessplanerstellung dabei, Inhalte klar zu strukturieren und den Finanzteil fachlich stimmig aufzubauen.

Branchenvergleich auf einen Blick
Die folgenden Punkte sind typische Richtwerte und Prüffragen. Sie ersetzen keine individuelle Kalkulation, helfen dir aber, die Logik je Branche sauber im Businessplan abzubilden.
| Branche | Geschäftsmodell / Erträge | Top-Kostenblöcke | Kern-KPIs (kurz erklärt) | Typische Fehler |
| Gastronomie / Café | Verkauf von Speisen und Getränken, Tagesumsatz getrieben durch Sitzplätze und Auslastung | Wareneinsatz, Personal, Miete/Nebenkosten, Ausstattung | Wareneinsatzquote (Anteil Wareneinsatz am Umsatz), Personalkostenquote, Auslastung je Stunde/Tag, durchschnittlicher Bon | Zu niedrige Auslastung angesetzt, Miete zu hoch, Personalkosten unterschätzt, fehlende Reserven |
| E-Commerce / B2C | Online-Verkauf physischer Produkte | Wareneinsatz, Marketing/Ads, Versand/Retouren, Plattform-/Payment-Gebühren | Deckungsbeitrag nach Retouren und Versand, Retourenquote, CAC (Kosten je Neukunde), CLV (Wert eines Kunden über die Zeit), Lagerumschlag | Marketingkosten und Retouren unterschätzt, Versandkosten vergessen, zu hoher Rabattdruck |
| Handwerk | Dienstleistungen + Materialverkauf | Löhne inkl. Nebenkosten, Material, Fahrzeuge/Anfahrt, Werkzeuge | Produktive Stunden je Mitarbeitendem, kalkulierter Stundensatz, Materialaufschlag, Auftragsbestand | Zu geringe produktive Stunden, Anfahrten nicht kalkuliert, zu wenig Gewährleistungspuffer |
| Heilberufe (Physio, Heilpraktik) | Behandlungen je Zeiteinheit, Kasse und Privat | Personal, Räume, Geräte, Dokumentation/Qualität | Auslastung je Behandlungszimmer, Anteil Privat/Verordnung, Ausfallquote, Durchschnittserlös je Termin | Zu optimistische Auslastung, zusätzliche Zeiten (Dokumentation) vergessen, Gerätekosten |
| Freie Berufe & Kreative | Projekt- oder Retainerhonorare | Eigenlohn, Akquise/Marketing, Software, Reisen | Tagessatz/Stundensatz, fakturierbare Tage, Pipeline-Quote, Zahlungsziele | Zu wenige fakturierbare Tage, Akquiseaufwand unterschätzt, zu lockere Zahlungsbedingungen |
| Tech / SaaS | Abo-Software, wiederkehrende Umsätze | Entwicklung, Hosting, Support, Vertrieb | MRR/ARR (monatlich/jährlich wiederkehrend), Churn (Abwanderung), CAC, CACPayback (Amortisationszeit) | Zu hohe Annahmen bei Wachstum, Churn unterschätzt, zu früh hohe Fixkosten |
| Soziale Unternehmen / gGmbH | Mischfinanzierung: Erlöse + Fördermittel/Spenden | Personal, Projektkosten, Wirkungsmessung, Verwaltung | Fördermittelquote, Eigenanteil, Projektdeckungsbeitrag, Wirkungs-Kennzahlen | Fehlende Kofinanzierung, Fristen übersehen, Wirkungslogik nicht belegt |
Gastronomie / Café
Was Finanzierende sehen wollen
- Auslastung realistisch über Tageszeiten (Frühstück, Mittag, Nachmittag, Abend) und Wochentage verteilt.
- Kostenquoten: Wareneinsatzquote und Personalkostenquote schlüssig zum Konzept.
- Miete als Prozentsatz vom Umsatz im Rahmen; Nebenkosten und Instandhaltung bedacht.
- Genehmigungen und Auflagen kurz benannt, Zeitplan realistisch.
Kennzahlen und Daumenregeln
- Wareneinsatzquote: häufig 25–35 Prozent je nach Sortiment.
- Personalkostenquote: oft 30–40 Prozent inkl. Arbeitgeberanteile.
- Miete + NK: idealerweise im niedrigen zweistelligen Prozentbereich des Umsatzes.
- Auslastung: nach Sitzplätzen, Öffnungsstunden, Drehung je Platz planen.
Mini-Rechenbeispiel
80 Sitzplätze, 10 Öffnungsstunden, durchschnittlicher Bon 12 Euro, 2,0 Platzdrehungen/Tag → Umsatz ≈ 80 × 2,0 × 12 = 1.920 Euro/Tag.
Bei 300 Öffnungstagen ≈ 576.000 Euro/Jahr.
Angenommen: Wareneinsatz 30 Prozent (172.800), Personal 35 Prozent (201.600), Miete+NK 10 Prozent (57.600), sonstige 8 Prozent (46.080) → vor Unternehmerlohn und Steuern bleiben ~98.000 Euro.
„Prüfe Stressszenario: bei 1,6 statt 2,0 Platzdrehungen sinkt der Umsatz um 20 Prozent – reicht die Liquiditätsreserve?“

ECommerce / B2C
Was Finanzierende sehen wollen
- Deckungsbeitrag nach Retouren und Versand klar ausgewiesen.
- Marketinglogik: CAC (Kosten je Neukunde) und erwarteter CLV (Wert eines Kunden über die Zeit) mit Annahmen zu Wiederkäufen.
- Retourenquote nach Produktkategorie plausibel.
- Betriebsmodell: Lager, Fulfillment, Zahlungsanbieter, Service.
Kennzahlen und Daumenregeln
- AOV (durchschnittlicher Warenkorb), Bruttomarge, Retourenquote, Versand- und Zahlungsgebühren, DB (Deckungsbeitrag) je Bestellung.
- CAC vs. CLV: Ziel ist, dass der CAC sich in akzeptabler Zeit amortisiert (z. B. 3–12 Monate, abhängig vom Modell).
Mini-Rechenbeispiel
AOV 60 Euro, Wareneinsatz 35 Prozent → 39 Euro Rohmarge.
Versand + Payment 6 Euro, Retourenquote 15 Prozent mit 8 Euro Rückabwicklungskosten → Deckungsbeitrag nach Retouren/Versand ≈ 39 − 6 − (0,15 × 8) = 31,8 Euro.
Wenn CAC 25 Euro ist, bleibt 6,8 Euro vor Fixkosten; lohnt sich erst bei Wiederkauf oder CrossSell.
„Sensitivität: Steigt die Retourenquote auf 25 Prozent, fällt der DB auf ~29 Euro – Anpassung im Marketingmix nötig.“

Handwerk
Was Finanzierende sehen wollen
- Stundensatzkalkulation nachvollziehbar aus Kostenstruktur und produktiven Stunden.
- Auslastung realistisch inkl. Reisezeiten, Angebotserstellung und Gewährleistung.
- Materialaufschläge und Einkaufsvorteile erklärt.
- Fahrzeug- und Werkzeugkosten vollständig berücksichtigt.
Kennzahlen und Daumenregeln
- Produktive Stunden je Monteur: häufig 1.400–1.600 pro Jahr (nach Abzug Urlaub, Krankheit, Organisation).
- Stundensatz deckt Lohn inkl. Nebenkosten, Gemeinkosten, Gewinnziel und Risiko ab.
- Materialeinsatz mit Zuschlägen zur Deckung von Handling und Gewährleistung.
Mini-Rechenbeispiel
2 Monteure × 1.500 produktive Stunden = 3.000 Stunden/Jahr.
Gesamtkosten (Löhne inkl. Nebenkosten, Fahrzeuge, Verwaltung, Miete, Versicherung) 210.000 Euro.
Gewinnziel 10 Prozent auf Umsatz. Benötigter Umsatz = Kosten / (1 − Gewinnziel) = 210.000 / 0,9 = 233.333 Euro.
Erforderlicher Stundensatz ≈ 233.333 / 3.000 = 77,8 Euro zzgl. Material.
„Prüfe: Passt das zu regionalen Marktpreisen und deinem Leistungsprofil?“
Heilberufe (Physio, Heilpraktik, Pflege)
Was Finanzierende sehen wollen
- Terminlogik: Kapazität je Behandlungszimmer und Fachkraft.
- Erlöse: Verhältnis Kassen- zu Privatleistungen transparent.
- Qualität und Dokumentation: Vorgaben eingeplant (Zeit- und Kostenfaktor).
- Investitionen: Geräte, Hygiene, ggf. Umbau mit realistischem Zeitplan.
Kennzahlen und Daumenregeln
- Auslastungsgrad je Raum/Fachkraft, Durchschnittserlös je Termin, No-Show-Quote (Nicht-Erscheinen), Behandlungsminuten.
- Breakeven basiert auf Terminen pro Tag × Erlös je Termin.
Mini-Rechenbeispiel
2 Behandlungsräume, 8 Behandlungsstunden/Tag, 30 Minuten pro Termin → 32 Termine/Tag bei 100 Prozent Auslastung.
Realistisch 70 Prozent → 22 Termine/Tag. Durchschnittserlös 35 Euro → 770 Euro/Tag, bei 240 Tagen 184.800 Euro/Jahr.
Fixkosten 120.000, variable Kosten 10 Prozent vom Umsatz → Ergebnis vor Unternehmerlohn ≈ 46.320 Euro.
„Hebel: Privatanteil steigern, Ausfallzeiten senken, Terminmanagement verbessern.“
Freie Berufe und Kreative
Was Finanzierende sehen wollen
- Leistungspakete oder Tagessätze klar beschrieben.
- Fakturierbare Tage realistisch (Akquise, Admin, Fortbildung abgezogen).
- Pipeline mit Angebot-zu-Auftrag-Quote nachvollziehbar.
- Zahlungsziele und Liquiditätspuffer eingeplant.
Kennzahlen und Daumenregeln
- Tagessatz/Stundensatz, fakturierbare Tage/Jahr, Auslastung, Debitorenlaufzeit (Zeit bis Zahlungseingang), Retainerquote.
Mini-Rechenbeispiel
Tagessatz 700 Euro, fakturierbare Tage 120/Jahr → 84.000 Euro Umsatz.
Fixkosten 18.000, variable Kosten 10 Prozent → Ergebnis vor Unternehmerlohn ≈ 57.600 Euro.
„Risiko: 60TageZahlungsziele können die Liquidität belasten – plane Puffer oder Abschläge ein.“
Tech / SaaS
Was Finanzierende sehen wollen
- MRR/ARR (monatlich/jährlich wiederkehrend) und Treiber: Neukunden, Churn, Expansion (Upsell).
- Churn (Abwanderung) klar definiert (Kunden- oder Umsatzabwanderung).
- CACPayback: Zeit bis sich Akquisekosten aus Deckungsbeiträgen amortisieren.
- Roadmap und Teamkosten im Verhältnis zu Wachstum.
Kennzahlen und Daumenregeln
- Bruttomarge hoch (Software), aber Support/Infrastructure beachten.
- Churn niedrig halten; Net Revenue Retention > 100 Prozent ist ideal bei B2B.
- CACPayback häufig Zielbereich 6–18 Monate je nach Markt.
Mini-Rechenbeispiel
100 Kundinnen × 39 Euro MRR = 3.900 Euro/Monat.
Monatlicher Churn 3 Prozent → Nettoabgang 3 Kundinnen/Monat.
Neugewinn 8/Monat → +5 Netto, MRRZuwachs ≈ 195 Euro/Monat vor Preisänderungen.
CAC 200 Euro, Bruttomarge 85 Prozent → monatlicher Deckungsbeitrag je Kunde ≈ 33,15 Euro; CACPayback ≈ 6,0 Monate.
„Achte darauf, dass SupportAufwand mitwächst und die Marge nicht schleichend sinkt.“
Soziale Unternehmen / gGmbH
Was Finanzierende und Fördermittelgeber sehen wollen
- Wirkungslogik: Problem, Zielgruppe, Aktivitäten, Ergebnisse, Wirkung messbar verbunden.
- Mischfinanzierung: eigene Erlöse, Fördermittel, Spenden; Kofinanzierung gesichert.
- Projektdeckungsbeiträge und Overhead sauber trennen.
- Fristen und Nachweise vollständig.
Kennzahlen und Daumenregeln
- Fördermittelquote (Anteil Fördermittel am Budget), Eigenanteil, Projektkosten je Wirkungseinheit (z. B. Kosten je teilnehmender Person), Wirkungs-Kennzahlen.
Mini-Rechenbeispiel
Projektbudget 250.000 Euro, Fördermittel 180.000 (72 Prozent), Eigenanteil 70.000 (Erlöse/Spenden).
Overhead 15 Prozent (37.500), direkte Projektkosten 212.500.
Ziel: 500 Teilnehmende → Kosten je Person 425 Euro.
„Risiko: Fehlende Kofinanzierung oder verspätete Auszahlungen gefährden Liquidität – plane Zwischenfinanzierung.“
Was muss dein Finanzplan ermitteln?
Dein Finanzplan soll klar zeigen, wie aus deiner Idee verlässliche Einnahmen werden und was sie begrenzt. Beschreibe die Logik deiner Branche konkret: Ein Café nennt Öffnungszeiten, Sitzplätze und typische Bons. Ein Onlineshop erklärt Bestellungen, Rücksendungen und Versand. So verstehen Leserinnen und Leser, warum deine Umsätze realistisch sind.
Als Nächstes beantwortest du, ob die geplante Menge leistbar ist. Wir rechnen grob durch, wie viele Aufträge, Bestellungen oder Termine pro Woche möglich sind mit Blick auf Personal, Räume und Zeit. Wenn Ziel und Kapazität nicht zusammenpassen, passt du Ressourcen oder Tempo an. Das wirkt glaubwürdig und spart spätere Korrekturen.
Dann klärst du den Geldfluss über die Zeit. Gewinne auf dem Papier helfen nicht, wenn Ausgaben früher fällig werden als Einnahmen. Erkläre kurz, wann Geld eingeht (zum Beispiel nach Lieferung oder Behandlung) und wofür es vorher ausgegeben wird (Einkauf, Löhne, Miete). Ein Satz zu deiner Liquiditätsreserve, also einem finanziellen Puffer für Schwankungen, zeigt, dass du auch hieran gedacht hast.
Fazit
Ein überzeugender Businessplan folgt der Logik deiner Branche: Wie entstehen Erlöse, welche Kostenblöcke sind prägend, welche Investitionen sind nötig, wie stabil ist die Liquidität und welche Finanzierung passt dazu. Die Unterschiede zwischen Gastronomie, E-Commerce, Handwerk, Heilberufen, freien Berufen, SaaS und sozialen Trägern sind groß. Darum zählt ein klarer, prüfbarer Aufbau mehr als lange Texte. Plane mit wenigen Treibern, dokumentiere Annahmen verständlich und teste jedes Modell mit einem einfachen Stresstest. So wächst die Chance auf einen bankfähigen Plan, teure Fehler sinken und die Finanzierung wird wahrscheinlicher.
Wenn dir Zeit oder betriebswirtschaftliche Kenntnisse fehlen, hol dir Unterstützung. So erhältst du saubere Unterlagen, eine fundierte strategische Planung und eine sichere Basis für deine Gründung.